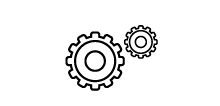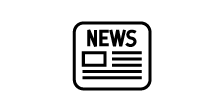Was uns das Gehirn über unsere Großzügigkeit lehrt
 Es gibt zwei Motivationen für Großzügigkeit: Wir geben aus Empathie (z. B. an eine Person, die uns tief berührt hat) oder aus Gegenseitigkeit (an eine Person, die uns behilflich war). Ein Team aus Psychologen und Neurowissenschaftlern an der Universität Zürich unter der Leitung von Grit Hein und Ernst Fehr konnte diese beiden Motivationen zum Geben mithilfe der Magnetresonanztomographie unterscheiden. Wie sehen Mitleid und Dankbarkeit im Gehirn aus?
Es gibt zwei Motivationen für Großzügigkeit: Wir geben aus Empathie (z. B. an eine Person, die uns tief berührt hat) oder aus Gegenseitigkeit (an eine Person, die uns behilflich war). Ein Team aus Psychologen und Neurowissenschaftlern an der Universität Zürich unter der Leitung von Grit Hein und Ernst Fehr konnte diese beiden Motivationen zum Geben mithilfe der Magnetresonanztomographie unterscheiden. Wie sehen Mitleid und Dankbarkeit im Gehirn aus?
In der Psychologie gelten Motivationen als unabhängig vom menschlichen Verhalten. Zudem handelt es sich um geistige Konstrukte, die sich nicht direkt beobachten lassen. Sie werden daher üblicherweise aus dem Verhalten der Personen abgeleitet. Dabei können unterschiedliche Beweggründe dasselbe Verhalten nach sich ziehen. Die Wissenschaftler haben sich bei dieser Studie gefragt, ob es möglich ist, unterschiedliche neurophysiologische Repräsentationen der einzelnen Beweggründe zu gewinnen und auf dieser Grundlage die Motivation eines Verhaltens zu bestimmen. Die Wissenschaftler wählten Situationen, in denen altruistische Entscheidungen gefragt waren, um zwei spezifische Motivationen zu untersuchen: die Empathie und die Gegenseitigkeit.
Dazu wurden die Teilnehmer in Situationen gebraucht, in denen sie egoistisch oder altruistisch entscheiden konnten. Insbesondere für den zweiten Entscheidungstyp untersuchten die Wissenschaftler die beiden genannten Formen: den Altruismus des Mitleids und den Altruismus der Gegenseitigkeit. Dazu wurden die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen geteilt. Die Teilnehmer wurden in jeder Situation mit einem Partner zusammengebracht. In der ersten Gruppe sah ein Teilnehmer, wie dem Partner Elektroschocks verabreicht wurden, und konnte anschließend Geld geben, um seinem Partner weiteres Leid zu ersparen. In der zweiten Gruppe wurde den Teilnehmern zuerst selbst in die Rolle des Opfers zugeteilt. Der Partner konnte dann zahlen, um weitere Elektroschocks zu verhindern. In der ersten Situation ging es darum, das Geben durch reines Mitleid auszulösen. In der zweiten Situation ging es darum, einer Person aufgrund von Gegenseitigkeit zu geben, weil diese dem Geber geholfen hatte.
Was konnten die Autoren der in der Zeitschrift Science veröffentlichten Studie bei den Teilnehmern im MRT nun beobachten? Im Gehirn fallen bei den Versuchen die dieselben drei Bereiche auf: der anteriore cinguläre Cortex, die anteriore Insula und das ventrale Striatum. Je nach Situation zeigen sie jedoch eine andere Dynamik. Während beim Altruismus des Mitleids der anteriore cinguläre Cortex die Insula aktiviert, die das ventrale Striatum blockiert, wird der anteriore cinguläre Cortex beim Altruismus des Mitleids auch selbst von der Insula aktiviert, und die Insula aktiviert das Striatum. Auf diese Weise können die Neurowissenschaftler mit der Magnetresonanztomographie leichter erkennen, in welcher Versuchssituation sich die Teilnehmer jeweils befanden.
Bei eher egoistischen Personen konnte mit der Empathiesituation zudem die Zahl der altruistischen Entscheidungen gesteigert werden (nicht jedoch mit der Gegenseitigkeitssituation). Bei von sich aus altruistischen Personen verhält es sich umgekehrt. Wenig großzügige Menschen konnten also zu mehr Großzügigkeit gebracht werden, wenn ihre Empathie angesprochen wurde. Von „Natur“ aus altruistische Menschen dagegen sind für die Mobilisierung ihrer (bereits umfassend aktivierten) Empathie weniger empfänglich, sondern eher für Situationen der Gegenseitigkeit.
Die Studie betont abschließend, dass je nach Motivation zum Geben unterschiedliche zerebrale Netzwerke bestehen, und führt an, dass unser altruistisches Verhalten sich je nach den Situationen, in die wir gelangen, entwickeln (steigern) kann.
Quelle: G. Hein et al., The brain’s functional network architecture reveals human motives, Science, 04.03.2016.